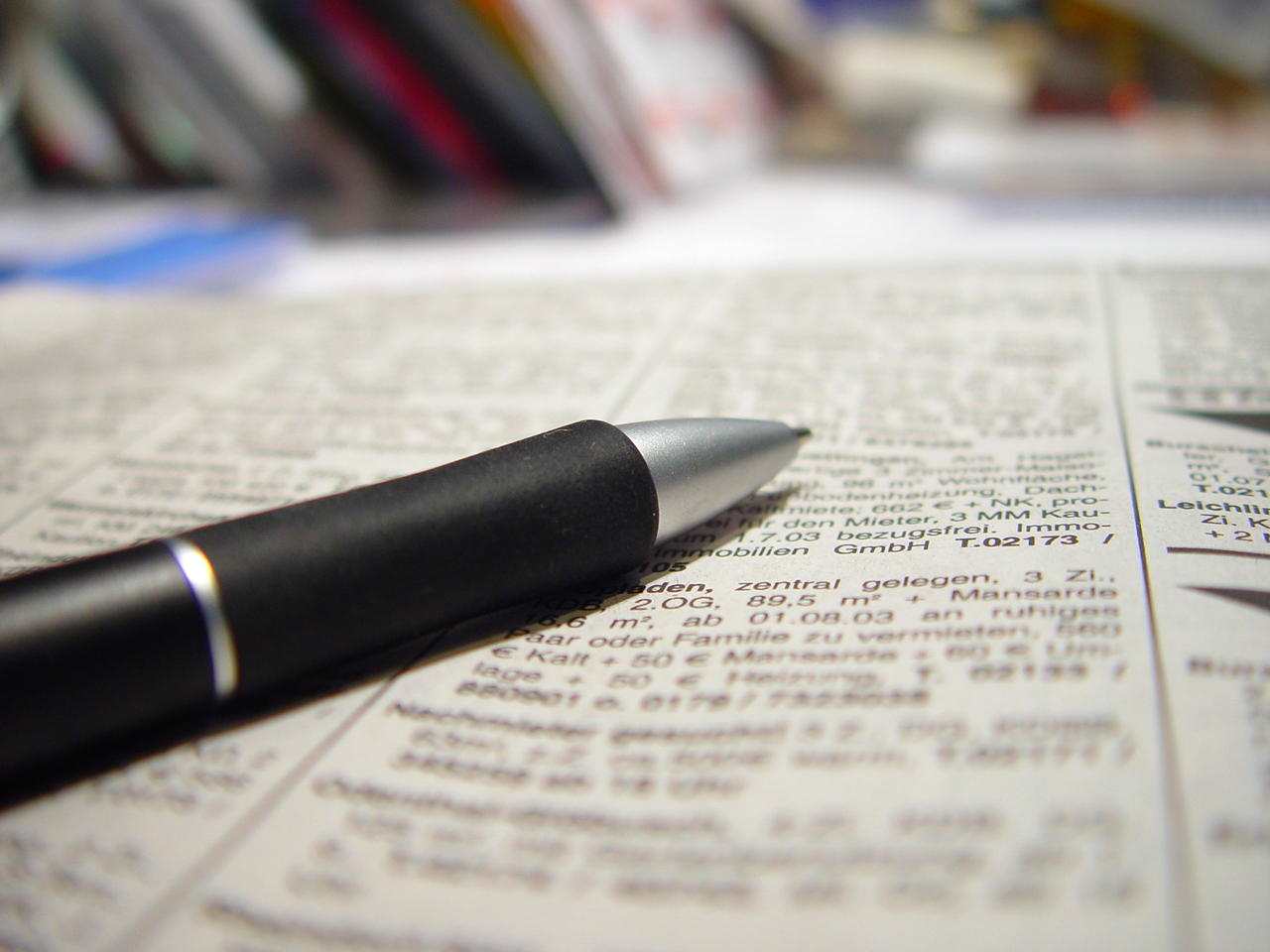Zwischen Gesten und Gestikulation
Als der im Februar 2025 neu vereidigte Bundeskanzler Friedrich Merz Warschau zum Ziel seines ersten Auslandsbesuchs wählte, sprachen viele Kommentatoren von einer historischen Geste. Ministerpräsident Donald Tusk verkündete einen „Neuanfang“ in den Beziehungen zu Deutschland. Polnische und deutsche Medien überboten sich gegenseitig mit optimistischen Prognosen. Ein Jahr später fällt die Bilanz dieses „Neuanfangs“ ernüchternd aus. Deutsche Politiker strecken weiterhin die Hand aus, die polnische Öffentlichkeit wendet sich zunehmend ab, und das Wort „Reparationen“ ist in die öffentliche Debatte zurückgekehrt wie ein Bumerang, den niemand auffangen wollte, der aber dennoch zurückkam.
Was ist schiefgelaufen? Und, was noch wichtiger ist: Hätte man das überhaupt vermeiden können?
Wenn Gesten nicht mehr ausreichen
Das Problem des „Neuanfangs“ bestand darin, dass er genau das sein sollte: ein Neuanfang – ein symbolischer Akt des Willens, eine Geste guten Willens, die aus sich selbst heraus eine neue Qualität erzeugen sollte. Dieses Denken ist charakteristisch für das Versöhnungsparadigma, das die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1989 geprägt hat. In dieser Logik galt Geschichte als eine Last, die schrittweise „entschärft“ werden musste, und symbolischen Gesten – wie Willy Brandts Kniefall (1970), der „Versöhnungsmesse“ (1989) oder Reden über gemeinsame Interessen, Schicksale, Werte und Ziele – wurde eine tatsächliche Wirkkraft zugeschrieben. Sie funktionierten, weil sie sich auf die authentische Erfahrung des Umbruchs bezogen, auf das Verlangen nach Normalität nach Jahrzehnten der Teilung.
Heute funktioniert diese Logik nicht mehr. Nicht deshalb, weil die Gesten unauthentisch oder schlecht durchdacht wären. Das Problem liegt tiefer: Der Kontext, in dem sie wahrgenommen werden, hat sich verändert. Für die Generation, die den Umbruch der 1980er und 1990er Jahre noch erlebt hat, klingt ein „Neuanfang“ wie das Versprechen einer Rückkehr zu etwas Bekanntem und Bewährtem. Für jüngere Generationen – jene, die die Teilung Europas nicht mehr erlebt haben und die europäische Integration als etwas Selbstverständliches und nicht als etwas Erkämpftes betrachten – wirkt eine solche Rhetorik wie eine Wiederholung aus dem Geschichtsbuch. Sie beantwortet nicht ihre Fragen nach Sicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit in einer Welt, die plötzlich unberechenbar geworden ist.

Profesor Krzysztof Ruchniewicz
Foto: Chris Archileos/wikipedia
Der Besuch von Merz in Warschau konnte eine Geste sein, doch er blieb eine Geste. Er führte weder zu einer Veränderung des Tons der öffentlichen Debatte noch stoppte er die wachsende Welle antideutscher Rhetorik, noch schuf er Mechanismen, mit denen sich unvermeidliche Konflikte hätten steuern lassen. Er wurde vielmehr, um ein drastisches Bild zu geben, zu einer Gestikulation: zu einer Bewegung, die etwas signalisiert, aber nichts verändert.
Projekte wie das Denkmal für die polnischen Opfer in Berlin, das Deutsch-Polnische Haus oder das gemeinsame Geschichtsbuch (Europa. Unsere Geschichte) bleiben wichtige Elemente der Beziehungslandschaft, sind jedoch nicht in der Lage, Instrumente zu ersetzen, mit denen sich ihre strukturelle Asymmetrie und unvermeidliche Konflikte bewältigen ließen.
Eine Asymmetrie, die wir nicht benennen wollen
Einer der Hauptgründe dafür, dass es nicht zu einem „Neuanfang“ kam, ist die Asymmetrie der polnisch-deutschen Beziehungen, über die wir entweder zu wenig oder auf eine grundsätzlich falsche Weise sprechen. Diese Asymmetrie hat viele Dimensionen: eine ökonomische (Deutschland ist wirtschaftlich etwa doppelt so groß), eine geopolitische (Berlin verfügt über einen größeren außenpolitischen Handlungsspielraum) und schließlich eine historische und erinnerungspolitische.
Gerade diese letzte Dimension ist besonders schmerzhaft, weil sie den Nerv der Identität berührt. Polen und Deutsche erinnern den Zweiten Weltkrieg auf radikal unterschiedliche Weise. Für Polen war er die Erfahrung einer totalen Besatzung, der Zerstörung staatlicher Strukturen, massiver Gewalt gegen die Zivilbevölkerung sowie des Verlustes der Unabhängigkeit über Jahrzehnte hinweg. Für Deutschland hingegen war er die Erfahrung von Schuld und Verantwortung, der Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, aber auch das Trauma von Vertreibungen und der Teilung des Landes.
Diese Erfahrungen sind moralisch nicht miteinander vergleichbar, sie sind jedoch strukturell asymmetrisch. Und genau das führt dazu, dass wir, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, über etwas anderes sprechen – selbst dann, wenn wir dieselben Worte verwenden.
Im Versöhnungsparadigma ging man davon aus, dass sich diese Asymmetrie schrittweise überwinden lasse – durch Dialog, Bildung und gemeinsame Erinnerungsprojekte. Heute wissen wir, dass diese Annahme übermäßig optimistisch war. Die Asymmetrie ist dauerhaft. Sie wird nicht verschwinden, weil sie aus der Struktur der historischen Erfahrungen selbst hervorgeht, die beide Nationen geprägt haben. Die Frage lautet daher nicht, wie man sie beseitigt, sondern ob wir lernen können, mit ihr zu leben, statt so zu tun, als gäbe es sie nicht.
Die Migrationskrise als Lackmustest
Der beste Beweis für die Fragilität des „Neuanfangs“ war die Krise rund um die deutschen Grenzkontrollen. Berlin beschloss unter innenpolitischem Druck, die Kontrollen für Asylsuchende zu verschärfen. Polen reagierte nervös und führte eigene Kontrollen ein, während sich in den sozialen Medien zunehmend eine Erzählung von „Massenabschiebungen“ von Geflüchteten nach Polen durchsetzte.
Es lohnt sich, bei diesem Vorfall innezuhalten, denn er zeigt etwas Wesentliches: In dem Moment, in dem reale Interessengegensätze auftraten, erwies sich die Symbolik des „Neuanfangs“ als hilflos. Es gab keinerlei Mechanismen, Verfahren oder Konsultationsformate, mit denen sich dieser Streit hätte steuern lassen. Übrig blieb allein die Rhetorik – und Rhetorik, der eine institutionelle Verankerung fehlt, schlägt rasch in gegenseitige Schuldzuweisungen um.
Deutschland streckt weiterhin die Hand aus. Polen blickt weiterhin mit Misstrauen. Vielleicht liegt das Problem jedoch nicht darin, dass die eine Seite auf die Geste der anderen nicht reagiert. Vielleicht liegt es darin, dass wir weiterhin auf Gesten warten, statt Mechanismen zu bauen.
Hinzu kommt, dass Donald Tusk – der als Garant des „Neuanfangs“ gelten sollte – selbst begann, eine Sprache zu verwenden, die bislang mit seinen politischen Gegnern assoziiert wurde. Seine Äußerung zu den Reparationen im Dezember, in der er betonte, das „polnische Volk habe in dieser Frage nichts zu sagen gehabt“, stand in scharfem Gegensatz zu seiner früheren Position vom Februar 2024, als er erklärte, die Frage sei „im formalen, rechtlichen Sinne abgeschlossen“. Dieser Wandel war kein Zufall. Er war eine Anpassung an innenpolitischen Druck und ein Signal dafür, dass in einer Konfliktsituation die Innenpolitik die Außenstrategie überlagert.
Reparationen: ein Konflikt, der sich nicht lösen lässt
Die Reparationsfrage ist vielleicht das beste Beispiel dafür, was wir an den polnisch-deutschen Beziehungen nicht verstehen. Wir behandeln sie wie ein Problem, das sich lösen ließe, während es sich in Wirklichkeit um einen strukturell unlösbaren Konflikt handelt.
Aus der Perspektive des Völkerrechts ist die Frage abgeschlossen. Aus der Perspektive des kollektiven Gedächtnisses und des moralischen Gerechtigkeitsempfindens bleibt sie offen. Keine Summe, keine Geste, keine Resolution wird diesen Streit beenden, denn es geht nicht um Geld. Es geht um die Anerkennung der Asymmetrie der Erfahrungen und um die Tatsache, dass keine „Entschädigung“ in den Augen jener ausreichend sein kann, die sich erinnern oder das Gedächtnis früherer Generationen in sich tragen.
Im Versöhnungsparadigma ging man davon aus, dass Dialog und symbolische Gesten diesen Konflikt allmählich zum Erlöschen bringen würden. Das ist nicht geschehen. Stattdessen kehrt er zyklisch zurück, jedes Mal mit größerer Intensität, und frustriert beide Seiten. Die Deutschen fühlen sich für etwas beschuldigt, für das sie sich ihrer Ansicht nach bereits entschuldigt und Verantwortung übernommen haben. Die Polen haben das Gefühl, dass ihr Leid nicht anerkannt wurde und dass das Gedenken an die Opfer politisch instrumentalisiert wird.
Gibt es einen anderen Weg? Ja – aber er erfordert einen radikalen Perspektivwechsel. Anstatt zu versuchen, das Reparationsproblem „zu lösen“, muss man lernen, es zu managen: seine Dauerhaftigkeit anzuerkennen, seinen destabilisierenden Einfluss auf andere Kooperationsbereiche zu begrenzen, die symbolischen Konflikte von der strategischen Zusammenarbeit zu trennen. Die Unterstützung der letzten noch lebenden Opfer des Nationalsozialismus und der deutschen Besatzung sollte nicht als „Geste gegenüber Polen“, sondern als Akt elementarer Gerechtigkeit gegenüber konkreten Menschen verstanden werden.
Das wird niemanden zufriedenstellen. Aber es wird ehrlich sein. Und es wird Beziehungen handlungsfähig halten, die heute Geisel eines Konflikts sind, den niemand gewinnen kann.
Gesellschaften „dazwischen“ – ein vergessenes Beziehungskapital
Es gibt eine Dimension der polnisch-deutschen Beziehungen, die immer seltener thematisiert wird, obwohl sie als eine Art Seismograph der Spannungen fungieren könnte: die Polen in Deutschland und die deutsche Minderheit in Polen.
Im Versöhnungsparadigma galten diese Gruppen als lebendiger Beweis für den Erfolg der Normalisierung – als Symbole der Überwindung historischer Trennungen, als „Brücken“ zwischen den Nationen. Heute befinden sich beide Gruppen in einer eigentümlichen Lage: Sie sind statistisch sichtbar, aber narrativ unsichtbar. Sie fungieren nicht mehr als Subjekte der Debatte über bilaterale Beziehungen, sondern eher als deren Objekt – selektiv herangezogen, wenn gerade ein politisches Argument benötigt wird.
Das ist eine deutliche Veränderung. Sie bedeutet den Verlust der Funktion, die diese Gruppen im früheren Paradigma erfüllten. Sie bedeutet jedoch nicht, dass sie an Bedeutung verloren hätten. Im Gegenteil: Unter Bedingungen wachsender Spannungen werden die Gesellschaften „dazwischen“ zu besonders sensiblen Indikatoren für Veränderungen im Beziehungsklima. Sie sind es, die die Folgen von Polarisierung, symbolischer Instrumentalisierung und wachsendem Nationalismus zuerst erfahren. In ihrem Alltagsleben – in Schulen, am Arbeitsplatz, im Kontakt mit Behörden – werden Spannungen sichtbar, die auf staatlicher Ebene noch im Bereich der Rhetorik verbleiben.

Die deutsch-polnische Grenze wird wieder geöffnet. Foto: Andreas Vogel/wikimedia commons
Aus analytischer Perspektive erinnert die Präsenz dieser Gruppen daran, dass polnisch-deutsche Beziehungen nicht nur aus Diplomatie und großer Politik bestehen, sondern auch aus Millionen konkreter menschlicher Erfahrungen – ambivalenter, widersprüchlicher Erfahrungen, die nicht in einfache Erzählungen von „Freundschaft“ oder „Krise“ passen. Im neuen Paradigma sollten sie eine andere Form der Präsenz erhalten: nicht als Beweis eines erfolgreichen Versöhnungsprozesses, sondern als Wissensquelle über die tatsächliche Dynamik der Beziehungen und darüber, wie sich politische Spannungen auf das Leben der Menschen auswirken.
Partnerschaft trotz Konflikten – nicht dank ihres Ausbleibens
Wenn ich den größten Denkfehler im Umgang mit den polnisch-deutschen Beziehungen benennen müsste, wäre es der Mythos der Harmonie: die Überzeugung, Beziehungen seien nur dann „gut“, wenn es keine Konflikte gibt, und jeder Streit sei ein Zeichen ihres „Krisenzustands“. Dieses Denken entstammt einer Epoche, die davon ausging, dass sich Geschichte „abschließen“ lasse und Europa in eine Ära dauerhaften Friedens eingetreten sei.
Heute wissen wir, dass dem nicht so ist. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Strategische Unsicherheit ist zu unserer alltäglichen Erfahrung geworden. Unter diesen Bedingungen können zwischenstaatliche Beziehungen nicht auf der Annahme der Konfliktfreiheit beruhen. Sie müssen auf der Fähigkeit beruhen, trotz Konflikten zusammenzuarbeiten.
Das nenne ich eine Partnerschaft asymmetrischer Verantwortung. Das ist kein schöner Begriff. Er klingt nicht wie „Neuanfang“ oder „Versöhnung“. Aber er beschreibt etwas Reales: eine Beziehung, in der
- die Asymmetrie von Erfahrungen, Erinnerung und Interessen anerkannt und nicht kaschiert wird,
- Konflikte als normal gelten und nicht als Anomalien, die sofort „therapiert“ werden müssten,
- Zusammenarbeit auf funktionaler Ebene stattfindet (Sicherheit, Wirtschaft, Infrastruktur) und nicht ausschließlich auf symbolischer,
- Geschichte nicht verschwindet, sondern ihre Funktion verändert: vom Instrument politischer Mobilisierung zum Gegenstand langfristiger Analyse,
- Verantwortung bedeutet, die Konsequenzen des eigenen Handelns zu managen und nicht um jeden Preis Konsens herzustellen.
Das Jahr 2025: verpasste Chance oder Lektion des Realismus?
War das Jahr 2025 ein Scheitern? Das hängt davon ab, was man erwartet hat. Wenn man glaubte, dass die symbolische Geste von Kanzler Merz und die Erklärung von Ministerpräsident Tusk ausreichen würden, um die Logik der Beziehungen zu verändern, dann war es ein Scheitern.
Wenn man dieses Jahr jedoch als Lektion des Realismus begreift, ergibt sich ein anderes Bild. Es hat gezeigt, dass das alte Paradigma erschöpft ist. Dass Gesten ohne institutionelle Mechanismen leer bleiben. Dass die Asymmetrie der Erfahrungen nicht verschwindet, nur weil man aufhört, über sie zu sprechen. Und dass jüngere Generationen eine andere Sprache benötigen als jene, die den Umbruch noch erlebt haben.
Deutschland streckt weiterhin die Hand aus. Polen blickt weiterhin mit Misstrauen. Vielleicht liegt das Problem jedoch nicht darin, dass die eine Seite auf die Geste der anderen nicht reagiert. Vielleicht liegt es darin, dass wir weiterhin auf Gesten warten, statt Mechanismen zu bauen.
Die Partnerschaft asymmetrischer Verantwortung verspricht kein glückliches Ende. Sie bietet ein stabiles Zusammenleben unter Bedingungen dauerhafter Unsicherheit an. Sie klingt weniger attraktiv als ein „Neuanfang“. Aber sie hat einen entscheidenden Vorteil: Sie ist ehrlich.
Und vielleicht hat sie gerade deshalb – paradoxerweise – eine Chance zu funktionieren.
Profesor Krzysztof Ruchniewicz
Der Text entstand als Antwort auf den Kommentar von Redakteur Krzysztof Świerc: